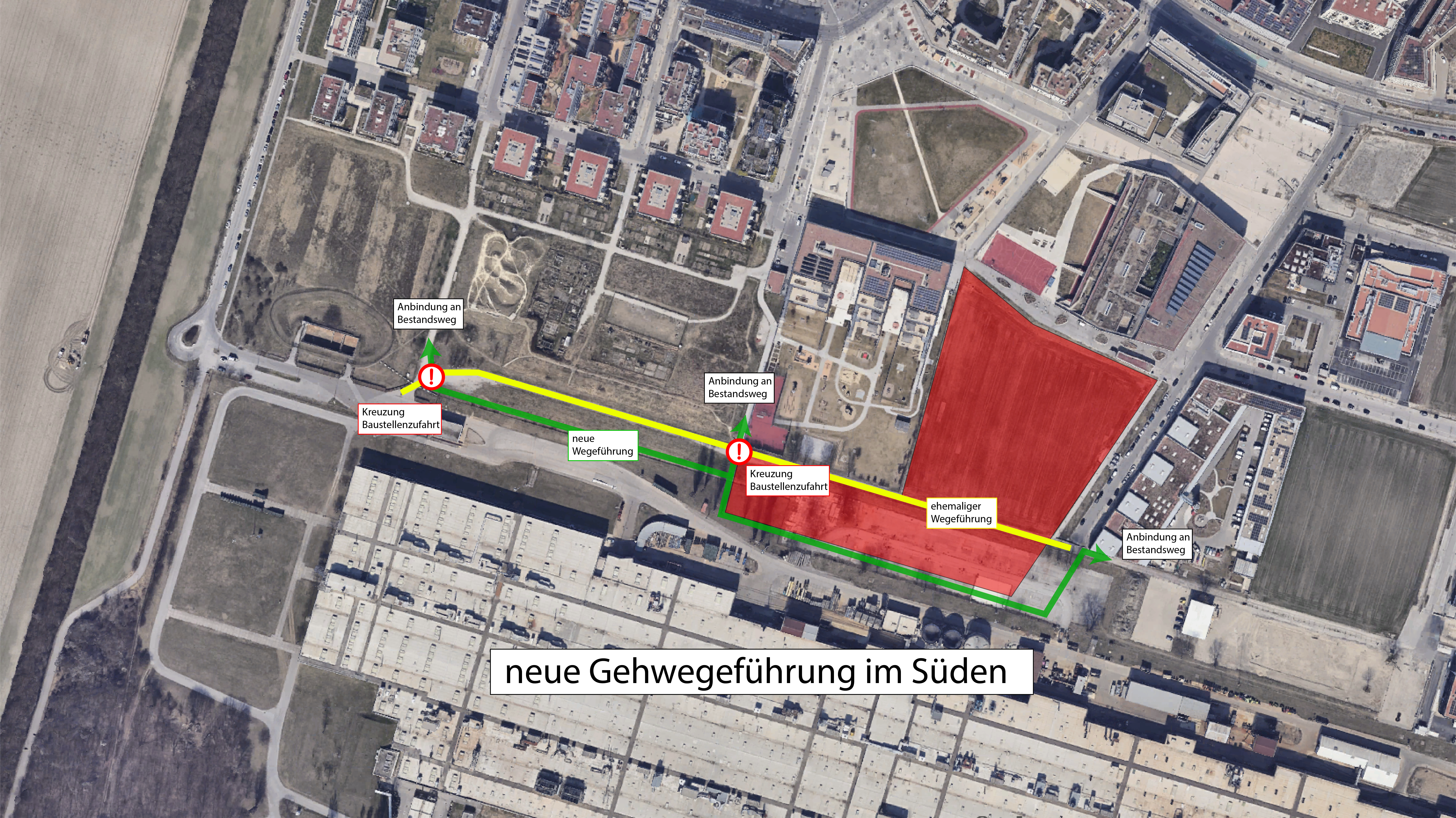aspern klimafit 2.0 – Der Gebäudestandard für die Zukunft
aspern klimafit 2.0 setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Bauen. Mit sieben klar definierten Kriterien – von Energieeffizienz bis Zirkularität – zeigt die Seestadt, wie klimafitte Gebäude schon heute Realität werden.

Ein neuer Maßstab für klimafittes Bauen
Klimaschutz und klimasensibler Städtebau sind seit Beginn zentrale Ziele der Seestadt. Alle Gebäude werden in der Seestadt nach den Standards des Total Quality Building (TQB) der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen geprüft. Mit dem Gebäudestandard aspern klimafit wurde dieser Anspruch weiterentwickelt. Von einem Expert*innenteam rund um FH Technikum Wien, Institute of Building Research & Innovation und Urban Innovation Vienna entwickelt, definiert der Standard, wie Gebäude gestaltet sein müssen, um den Anforderungen eines treibhausgasneutralen Lebens bis 2040 gerecht zu werden.
Wirkung: Weniger Emissionen, mehr Lebensqualität
Durch einen Mix aus Maßnahmen in den Bereichen Bauen, Wohnen, private Nutzung und Mobilität lässt sich der CO₂-Fußabdruck wesentlich reduzieren.
aspern klimafit vereint folgende Kernaspekte
durch hocheffiziente Gebäudehüllen und Klimatisierungstechnologien mittels Fernwärme, Bauteilaktivierung und Niedertemperaturheizsystemen
aus Solarenergie und Umgebungswärme mit hohem Eigenversorgungsgrad und Nutzbarmachung von Stromüberschüssen zur Versorgung moderner E-Mobilität
durch optimierte Fassadengestaltung, außenliegenden Sonnenschutz und Nutzung der Bauteilaktivierung zur Kühlung
Verringerung des Bedarfs an „grauer Energie“ durch kreislaufwirtschaftliche Konzepte
aspern klimafit 2.0 – was ist neu?
Der ursprüngliche Gebäudestandard kam im Quartier Seeterrassen erstmals zum Einsatz und wurde 2024 zu aspern klimafit 2.0 weiterentwickelt.
Auf der Basis von Detailuntersuchungen und bisherigen Erfahrungen wurden die anfangs sechs Qualitätskriterien adaptiert. Als grundlegendste Anpassung wurden in der Überarbeitung quantitative Vorgaben für das Qualitätskriterium 5, die „CO₂-reduzierte Gebäudeerrichtung“, – also die maximal verbauten Emissionen – definiert.
Zudem wurde als neues, siebtes Qualitätskriterium die „Zirkularität“ ergänzt, da kreislauffähige Gebäude sowohl den Ressourcenverbrauch als auch die Emissionen minimieren.
Sieben Qualitätskriterien für klimafittes Bauen
aspern klimafit 2.0 umfasst sieben miteinader verzahnte Kriterien:
Gebäude sollen möglichst wenig Energie verbrauchen, etwa für Raumheizung, Warmwasserbereitung, Raumkühlung oder Stromanwendungen. Dafür gelten klare Mindeststandards beim Energiebedarf und bei den CO₂-Emissionen.
Ein Wohnbau, ein Studierendenheim und ein Bildungscampus dienen als Smart-Building-Testobjekte der ASCR. Ausgestattet mit Photovoltaik, Solarthermie, Hybridanlagen, Wärmepumpen sowie verschiedenen thermischen und elektrischen Speichern, fungieren die Gebäude nicht nur als Verbraucher, sondern auch als aktive Energieerzeuger.
Gebäude verfügen über nennenswerte Potenziale, ihren Leistungsbedarf an die „volatile“ Erzeugung vor allem von Solar- und Windenergie anzupassen. Thermische oder elektrochemische Energiespeicherung hilft dabei, das Netz zu entlasten.
Ein wirksamer Sonnenschutz, eine technische unterstützte Temperierung – etwa über den Fußboden oder die Decke – sowie Begrünung sorgen dafür, dass Gebäude auch in heißen Sommern angenehm nutzbar bleiben.
Auch beim Bau selbst wird auf Klimaschutz geachtet: Materialien und Bauweisen sollen möglichst geringe Treibhausgas-Emissionen verursachen. Berücksichtigt werden neben den direkt bei der Errichtung der Gebäude anfallenden Treibhausgasen auch die Speicherung von biogenem Kohlenstoff und verstärkte Kalzinierung.
Neue Gebäude müssen klimafreundliche Mobilität fördern, beispielsweise durch Fahrradabstellplätze, E-Ladestellen, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, einen angepassten Stellplatzschlüssel und E-Carsharing-Angebote.
Gebäude werden so geplant, dass Materialien wiederverwendet, die Nutzungsdauer verlängert und Rückbau am Ende erleichtert werden. So entstehen echte Kreisläufe im Bauwesen.