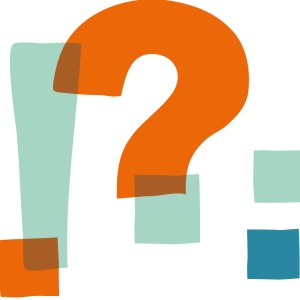Der asperner See in der Seestadt - für viele Bewohner*innen ist dieses kühle Juwel zweifellos das Highlight
ihres Stadtteils. Damit der See auch weiterhin ein schöner und sicherer Naherholungsort bleibt, haben wir für Sie einige hilfreiche
Tipps zusammengefasst:
Seit Beginn der Badesaison 2024 ist die Nutzung des Steges in Teilbereichen
wieder möglich. Allerdings gilt beim Steg, laut Wasserrechtsbescheid, ein Badeverbot, d.h. von hier ist der Zugang
zum Wasser nicht erlaubt. Das ist eine Maßnahme der Behörde, um die Wasserqualität zu schützen. Der Bescheid beinhaltet
auch ein sogenanntes „Attraktivierungsverbot“ am nördlichen Ufer. Dieser Bereich des Sees ist als Naherholungszone gestaltet:
mit dem Steg, der zur Abdeckung der Spundwand dient und Notausstiegen aus Sicherheitsgründen. Mülltonnen und WCs helfen, den
See und das Ufer sauber zu halten. Zusätzliche Infrastruktur ist nicht erlaubt.
Am Südufer gibt's genug Möglichkeiten
zum Abkühlen. Und bitte beachten: Das ins Wasser Springen ist nicht nur vom Steg verboten, sondern auch von den Brücken!Hier
können Sie weiter lesen, was Sie so alles bei einem Naturbadeplatz beachten sollten:
Unser See ist ein
Naturbadeplatz. Das heißt, es gibt keinen Nichtschwimmer*innen-Bereich
und keine Badeaufsicht. Beim Baden ist daher besondere Vorsicht geboten – vor allem für ungeübte Schwimmer*innen
bzw. Nicht-Schwimmer*innen. Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme ist, das sichere Schwimmen unbedingt zu beherrschen! Kinder dürfen beim
Baden unter keinen Umständen unbeaufsichtigt sein.
Zu den Gefahren, die Naturbadeplätze mit sich
bringen können, zählen:
- geringe Sichttiefen
- unterschiedliche Temperaturschichten
Außerdem
wird der asperner See unmittelbar nach dem Uferbereich mehrere Meter tief, so dass kein Stehen mehr möglich ist.
Daher empfiehlt es sich für ungeübte Schwimmer*innen und Nichtschwimmer*innen, auf das breite Angebot der Wiener Schwimmbäder
zurückzugreifen, wo es klar gekennzeichnete Nichtschwimmer-Bereiche und Kinderbecken sowie Bademeister*innen gibt. Außerdem
werden hier diverse Schwimmkurse für Teilnehmer*innen aller Altersstufen und mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen angeboten.
Noch ein Tipp für das sichere Baden im See: Achten Sie auf gekennzeichnete Zustiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten,
die sich an den beiden ausgewiesenen Badebuchten befinden.
Hier
finden Sie auch Informationen zur sicheren Nutzung des Badesees.Sollte es doch zu einer
Notsituation kommen,
ist es wichtig folgende Regeln zu beachten:
- Unfallstelle einprägen und
auch rasch anderen Personen mitteilen
- Notruf wählen – Feuerwehrnummer 122 (!)
- Retten nur, wenn man sich
selber nicht in Gefahr bringt – sonst Hilfe holen (Rettungsringe)
- Wichtig: Im Norden gibt es Lotsenpunkte. Der nächst
gelegene Lotsenpunkt sollte an die Einsatzkräfte durchgegeben werden. Diese befinden sich wie im Plan eingezeichnet (siehe
Bildergalerie). Zusätzlich gibt es im Süden Nummern an den Rettungsringen ebenfalls Nummern, die ebenfalls an die Rettungskräfte
weitergegeben werden sollen. So gelingt eine schnelle Hilfe.
- Nach der Bergung lebensrettende Maßnahmen bis zum Eintreffen
der Einsatzkräfte setzen (Defibrillator befindet sich beim Lokal Tschau Tschau am See)
Prinzipiell
gilt: Das Achten auf badende Kinder und Erwachsene ist unter Umständen lebensrettend! Auch Sie können zum sicheren Baden in
der Seestadt beitragen.
RettungsringeWie es der Name schon sagt, sind die Ringe
für den Notfall reserviert. Sie sind also da, wenn eine Person aus dem Wasser gerettet werden muss. Sollten Sie sehen, dass
ein Rettungsring fehlt, können Sie es gerne in der
Sag's
Wien App melden.
Wo sind die WCs rund um den See?Es gibt eine
mobile Toilette im Seepark. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an Sags Wien. Außerdem befinden sich an der U-Bahn-Station
Seestadt Ausgang Seestadtstraße und im Elinor-Ostrom-Park öffentliche WCs. Zusätzlich stehen Öklos am Nordufer des Sees und
beim Madame-d‘Ora-Park zur Verfügung. Im
interaktiven
Stadtteilplan finden Sie diese auch verortet.
Neben dem Tschau Tschau, dem Bistro am südlichen Seeufer, finden
Sie einen (kostenpflichtigen) WC-Container.
Zu den Abendstunden wird es bekanntlich immer lustiger und die Lautstärke hebt sich. Jedoch gilt auch in der Seestadt:
Nachtruhe
im Wohngebiet ab 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Da das auch manchmal in Vergessenheit geraten kann, gibt es auch heuer in
der Sommersaison einen Security-Dienst, der täglich im Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr Früh mehrere Kontrollgänge rund
um den See durchführt und hilft, Lärmbelästigung einzudämmen. Er ist befugt, Personen zu kontrollieren und entlang des Nordufers
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr wegzuweisen.
Sollten Sie selbst strafbares oder rücksichtsloses Verhalten beobachten,
wenden Sie sich bitte an die Polizei!
Dürfen Hunde mit ins Wasser?Ja, es gibt einen
Seezugang
für Hunde! Im Seepark östlich der U-Bahn-Station befindet sich
eine großzügige Hundezone (siehe Plan) mit
Wasserzugang für die Hunde. Im Seepark besteht sonst auf den Wegen und Wiesen sowie in den Uferbereichen und im Wasser Hundeverbot.
Auf der Nordseite dürfen Hunde an der Leine geführt werden, allerdings dürfen sie auch dort nicht ins Wasser. Weitere Hundezonen
finden Sie im
interaktiven
Stadtteilplan (Elenor-Ostrom-Park, Madame d'Ora-Park, Bushaltestelle Johann Kutschera Gasse).
Ist
das Füttern der Tiere in Ordnung?Hinweisschilder am gesamten Gelände weisen darauf hin, dass das Fischen sowie
das Füttern von Fischen und Wasservögeln nicht erlaubt sind. Das ist nicht nur wichtig, um die Wasserqualität zu bewahren.
Vor allem schadet das „Futter“ den Tiermägen. Es können dadurch Koliken ausgelöst werden, die die Gesundheit der Tiere gefährden.
Wie schaut es mit Müll am See aus?
Die Wien 3420 lässt im Norden mehrmals die Woche
den Müll sammeln und die Tonnen entleeren. Im Süden des Sees (Seepark) kümmert sich die Stadt Wien um die Reinigung und regelmäßige
Entleerung der Mistkübel.
Natürlich ist das ein toller Service - wir möchten Sie dennoch zur
Selbstverantwortung und Solidarität mit ihren Mitmenschen auffordern. Helfen Sie mit die Seestadt gemeinsam so zu gestalten,
dass wir uns hier alle wohlfühlen.